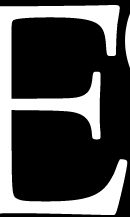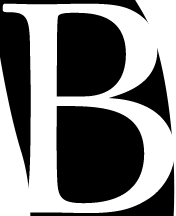Als Kind habe ich wenig gezeichnet – zu Hause war man aufs Ueberleben bedacht; kurz nach dem Krieg war kaum etwas wie Kunst-Bewusstsein vorhanden. Als Primar- und Sekundarschüler hatte ich keine Zeit zum Zeichnen, da ich nach der Schule arbeiten musste. Erst in der Mittelschule kannte ich bewusst freie Zeit – hier beginnen denn auch meine ersten schöpferischen Versuche. Ich schrieb poetische, romantische und rüpelhafte Texte, begann einen Roman und spielte Klarinette in einer Jazzband.
Schreiben und Musikmachen versickerten für Jahre, als ich 1957 zu malen begann. Ich habe neben meinem Beruf als Lehrer genug Zeit gefunden, um mich langsam als Maler autodidaktisch entwickeln zu können. Meine erste Einzelausstellung mit Oelbildern bestritt ich, als ich noch Schule gab.
Seit ich freischaffender Künstler bin, hat alles ganz andere Ausmasse angenommen: Das Leben, die Freiheit, das Atelier, die Zeit, die Kräfte; auch die Lust, Neues zu lernen. In den elf Jahren freien Schaffens habe ich immer wieder neue Techniken versucht und im bildnerischen Gestalten mehrmals eigene, geglaubte Grenzen verschoben.